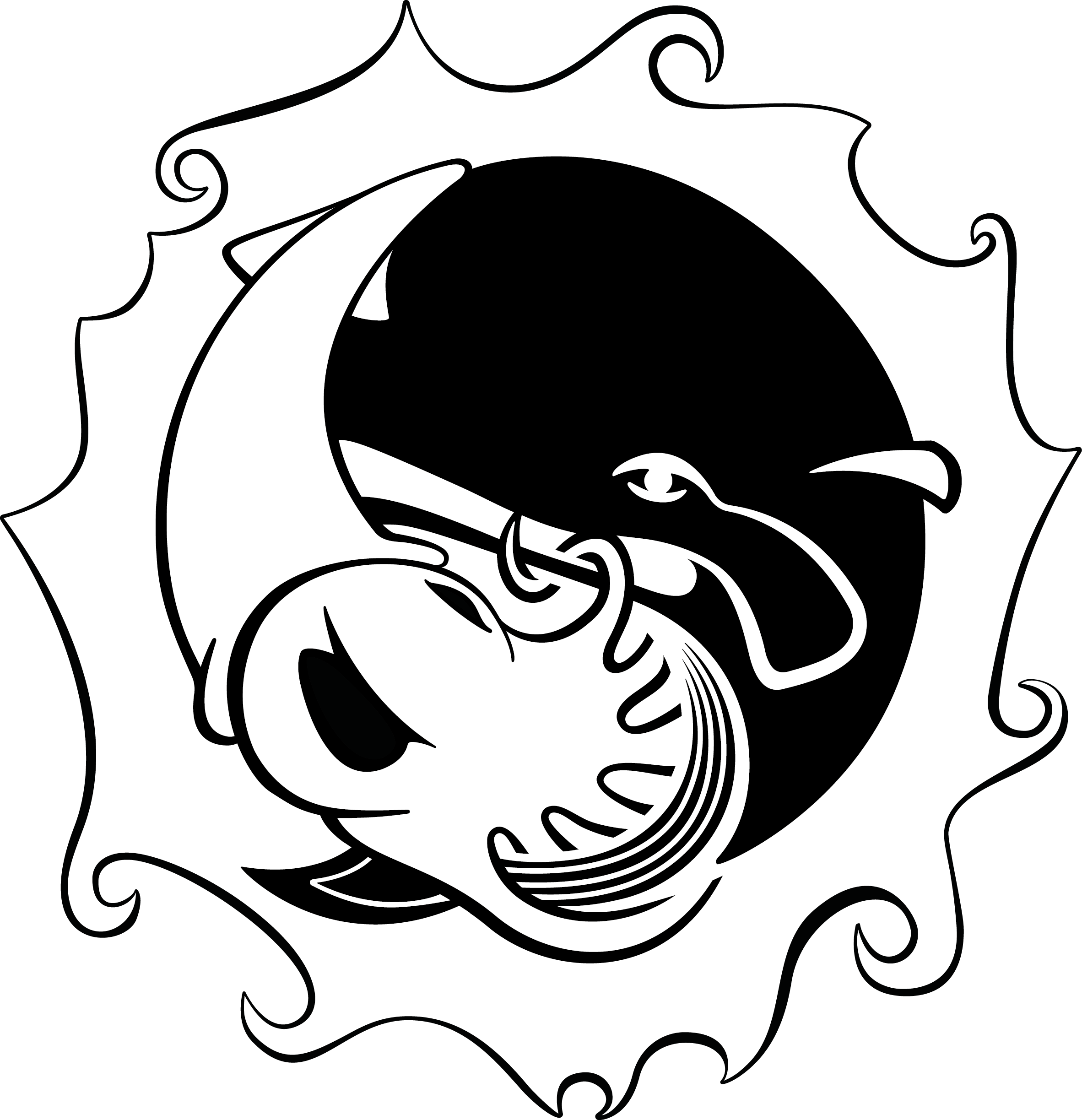Leseprobe "KAMIKAZE"
Es gibt Zeiten im Leben eines Menschen, in denen alles anders ist. Wo die Welt Kopf steht, das Herz zu Stein wird, das Blut so dick wie Sirup fließt und die Gedanken konsequent schrecklich und unmenschlich die Seele peinigen. Es wird ausschließlich gedacht. Angedacht und dann bedenkenlos zerdacht. Dann ist man eine Maschine, eine Fress- und Denkmaschine, ohne Sinn und ohne Ziel. Außer der Tod wäre Sinn und Ziel zugleich. Ich bin, nein, ich muss eine Maschine sein. Ich spüre, fühle nichts mehr. Häufig denke ich an den Tod. Im Traum bin ich schon oft gestorben und anstatt aufzuwachen, in diesem einen Todesmoment, bleibe ich im Schlaf, denn nichts will ich in diesem Augenblick mehr wissen als das Geheimnis des Todes. Tut es weh? Wird es schwarz? Fällt das Bild aus, wird es zu statischem Rauschen, wie bei einem kaputten Fernseher? Werde ich die Wahrheit erfahren, oder führe ich mich dabei nur selbst aufs Glatteis? Im Traum wird es eigentlich immer weiß. Ich sterbe und es wird weiß, ganz überraschend, eigentlich. Für mich ist der Tod weiß, nicht schwarz, also kein Grund zur Angst. Weiß. Die Gedanken bleiben. Zumindest im Traum. Aber wie lange? Immer diese Neugier, als ob es keine anderen Gedanken gäbe! Als ob man als Mensch keine anderen Probleme als das Geheimnis des Todes hätte. Probleme. Eigentlich habe ich keine Probleme. Außer die Einsamkeit, aber sie ist auch, wenn man sich einmal damit abgefunden hat, nicht zu sehr bedrückend. Leicht wird sie niemals, aber der Druck lässt nach. Langsam, wie die Luft schleichend aus einem Reifen entweicht, bis der Widerstand mit der Erde mühselig, unangenehm wird.
So oder so ähnlich dachte ich immer im Halbschlaf, wenn ich so vor mich hindöste, wissend, gleich diesen wunderbaren Dämmerzustand unterbrechen zu müssen, um dem Tagwerk nachzugehen, das mir immer über den Tag half. Dämmerzustand, Tagwerk, Rausch. Das waren die tagtäglichen Verhältnisse, die mich von Sonnenuntergang zu Sonnenaufgang retteten, beziehungsweise von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang vor der bösen Gedankenwelt, die einen immer in die Finsternis stürzt, beschützten. Wenn es dunkel wird, brechen die Gedanken herein, wie Heuschreckenschwärme und sie zerfressen einen bis auf die Knochen. Dann kann nur mehr Feuer helfen, Feuer und Rausch. Eine Flasche. Oder mehr, bis die Gedankenheuschrecken schlafen. Bleibt man nüchtern, verliert man den Verstand. Alles wird wild und konfus, die Erde dreht sich und mir wird schwindlig. Man taumelt nur mehr von A nach B, während man sich den Stillstand wünscht, die Gelassenheit, das göttliche Phlegma des Depressiven auf Antidepressiva.
Es klopfte an der Tür. Ich wuchtete mich hoch wie einen schweren Sack und öffnete. Nackt und darauf scheißend, dass ich nackt war.
Eine Nachbarin blickte mich mit riesigen Augen an und meinte, sie wolle sich Zucker ausborgen, doch dann fügte sie hinzu, dass ich es wohl wäre, der Zucker benötigte. Ich dachte schon, sie wollte zugreifen, oder an mir vorbei in meine Wohnung eindringen, doch mein regungsloser Blick, meine starre Mimik, hielt sie wie ein Schutzschild, wie eine unangenehme Aura, davon ab und sie drehte sich um und ging ohne ein weiteres Wort fort.
Ich schlurfte verschlafen in die Küche, trank einen Schluck Wasser, das mir über das Kinn auf meinen nackten Körper tropfte, und ihn so ein wenig wachküsste.
Wieder im Bett döste ich scheinbar endlos vor mich hin, wie erschlagen und unfähig, mich zu rühren. Doch ich hatte heute viel zu tun. Zuerst das Wichtigste, und ich wäre nicht ernsthaft aufgestanden, bevor das nicht erledigt war: der Rausch. Nüchtern am Wochenende aufzustehen wäre eine Unzumutbarkeit, eine Unverschämtheit meiner ureigensten Hölle gegenüber. Und es war dringend, denn der Schnaps von gestern verlor langsam, aber sicher seine Wirkung und nicht nur die Sonne brach in mein Zimmer. Nüchternheit wagte sich einen Schritt herein, in mich, hinaus, in die Welt, die mir schon lange nichts mehr bedeutete.